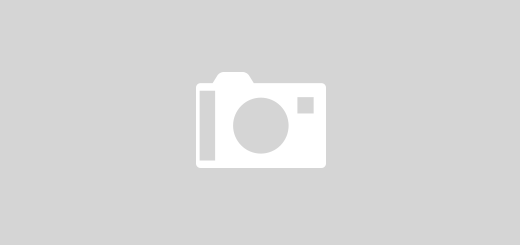© fotolia.com
Die Privatinsolvenz muss differenziert werden von der Firmeninsolvenz. Während es bei einer Privatinsolvenz eine „Vorstufe“ mit außergerichtlichen Einigungsversuchen gibt, ist eine Firmeninsolvenz mit dem Antrag auf Insolvenzeröffnung – gestellt von wem auch immer – beschlossene Sache, wird im Handelsregister veröffentlicht und muss einen vorgezeichneten Weg gehen um die Forderungsansprüche der Gläubiger zu befriedigen.
Forderungsverkauf für mehr Liquidität
Firmeninhaber oder die eine Firma vertretenden Personen müssen so handeln, dass die Firmenkosten gedeckt sind. Dazu gehören Steuern und Versicherungen genauso wie Personal- und Raumkosten. Je nach Art des Unternehmens fallen meistens Kosten im Wareneinkauf sowie der Beschaffung dieser an. Nicht selten kommen Unternehmer in Situationen, in denen sie – sei es durch Zahlungsrückstände der Kunden oder durch Fehlkalkulationen – kurzfristig nicht mehr zahlungsfähig gegenüber ihren eigenen Gläubigern sind.
In diesem Fall können Forderungen noch an Unternehmen verkauft werden. Dann ist die Sprache von liquiditätssichernder Forderungsabtretung. Der Unternehmer erhält zwar nicht das komplette Geld für die Forderung, jedoch einen gewichtigen Teil hiervon. Zur Abwendung einer Insolvenz ist das eine oft eingeschlagene Route, mit der viele Unternehmen nochmal „die Kurve gekratzt haben“.
Unternehmensinsolvenz – Wenn der Unternehmer kein Unternehmer mehr ist
Ist jedoch die Insolvenz beantragt, so ist der Handlungsspielraum des Unternehmers empfindlich eingeschränkt. Er besitzt gegenüber dem Insolvenzverwalter nur noch wenig Mitspracherecht und darf ohne dessen Einwilligung keine unternehmerischen Rechtshandlungen mehr vornehmen. Der gerichtlich beauftragte Insolvenzverwalter hat nun die gesamte Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis.
Ganz deutlich hat der Staat nämlich mit der Insolvenzordnung gesetzlich verankert, wer zuerst sein Geld bekommt: Das Finanzamt, die Krankenkassen, der Insolvenzverwalter. Der Rest vom Kuchen, wenn noch was da ist, wird unter der Gläubigermasse verteilt. Eine Forderungsabtretung im Insolvenzfall ist also nur noch aus Gläubigersicht möglich und mit Vorsicht zu genießen. Der Verkäufer der Forderung hat eine Aufklärungspflicht gegenüber demjenigen, dem er die Forderung abtreten oder verkaufen möchte.
Anderenfalls wäre das ein Verstoß gegen die guten Sitten wie Treu und Glaube, die im Grundgesetz verankert sind und kann zivilrechtlich oder sogar strafrechtlich verfolgt werden. Wenn die Gründe für die Forderungsabtretung, in diesem Fall Insolvenz des Schuldners, jedoch akzeptiert werden, erhält der Gläubiger meist schneller sein Geld als wenn er darauf wartet, bis der Insolvenzverwalter die Verteilungsschlüssel für die Insolvenzmasse des Schuldnerunternehmens errechnet hat und diese zu verteilen gedenkt.
Privatinsolvenz – Vorrang außergerichtlicher Einigungsversuche
Die Privatinsolvenz unterscheidet sich nur geringfügig von der Firmeninsolvenz. Häufig sind Privatpersonen doch eher mit dem Ehrgeiz begnadet, aus ihrer finanziellen Misere wieder herauszufinden. Arbeitsagentur oder Freunde bieten meist ein Fundament, auf dem die finanziell schlechte Situation überbrückt und überwunden werden kann. Eingangs erwähnte „Vorstufe“ vor dem eigentlichen Insolvenzantrag gestattet es der Privatperson, ihre finanziellen Mittel selber zu überblicken und auch selbstständig Forderungen abzutreten oder zu verkaufen.
Selbst Geld einfordernde Behörden und Unternehmen zeigen sich häufig nachsichtig und bieten Ratenzahlungen an, bevor sie bei Privatpersonen einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit stellen. Eine Privatinsolvenz resultiert daher meist aus der Erkenntnis und Verzweiflung des Betroffenen selbst, der alleine nicht mehr weiter weiß. Forderungen sind in der Privatsphäre seltener vorhanden und besitzen meist auch einen anderen Charakter als unternehmerische, welche häufig nahezu anonymisiert sind.
Der Unterschied zur Unternehmensinsolvenz ist lediglich der, dass im Rahmen des Gläubigerschutzes nicht so schnell ein Insolvenzantrag bei Privatpersonen gestellt wird, wie bei zahlungsunfähigen Unternehmen. Hat eine privatinsolvente Person jedoch Forderungen, etwa aus nicht gewerblicher Vermietung, einem früheren Geldverleih oder der Rückforderung von Überzahlungen beim Energieanbieter etc., können diese ebenso wie im Geschäftsverkehr verkauft oder abgetreten werden.
Der Zwang ist bei Privatpersonen jedoch eher nicht gegeben, denn diese wenden sich im Falle einer Privatinsolvenz lediglich an eine Schuldnerberatung. Diese wird auf solche Möglichkeiten hinweisen, wenn vorhanden. Hat eine Schuldnerberatung jedoch die Zügel in die Hand genommen, Ratenzahlungsvereinbarungen mit Gläubigern getroffen und weitere Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung getroffen, dürfen derartige Forderungen ebenfalls nicht mehr eigenmächtig veräußert werden.
Vor dem Verkauf vergleichen
Zwar sind gerichtlich bestellte Insolvenzverwalter und Schuldnerberater verpflichtet, bei Forderungsabtretung die günstigste Lösung für ihren Klienten zu wählen. Manchmal lohnt sich jedoch ein Blick über den Tellerrand. Deshalb sollte die insolvente Person selber ebenfalls recherchieren. Denn wie bei allen Unternehmen gibt es in der Branche der Forderungsankäufe mannigfaltige Unterschiede bei den Kosten, die diese erheben. Sorgen Sie daher selber dafür, dass tatsächlich die kostengünstigste Möglichkeit gewählt wird.